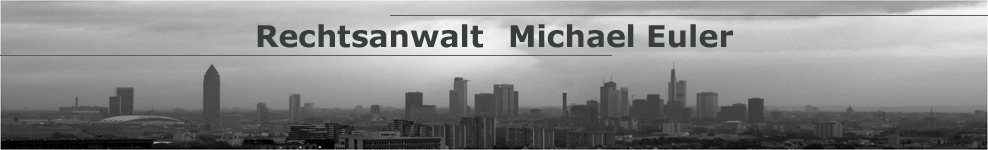
Michael Euler info (at) ra-euler.de
|
| l Filesharing, die Folgen und Auswege aus der Haftung | ||
I. Einführung Zurzeit sind mehrere auf Urheberrechtsversöße spezialisierte große Anwaltskanzleien damit beschäftigt, im Namen der Musik- und Videoindustrie gegen das illegale Verbreiten von Musik- und Videomaterial im Internet vorzugehen. Die beauftragten Rechtsanwälte gehen massiv per Abmahnung gegen diejenigen vor, die über Tauschbörsen urheberrechtlich geschütztes Material anbieten. |
 |
|
Dabei ist vielen Nutzern von Tauschbörsen nichteinmal bewusst, dass diese die abgemahnten Dateien auch im Internet anbieten und sich damit der Abmahnmaschinerie der Rechteinhaber aussetzen. Die Software, welche zum Download der entsprechenden Files benötigt wird, ist nämlich in der Regel so konfiguriert, dass bei einem Download automatisch auch ein Upload der zuvor heruntergeladenen Dateien erfolgt. Vielfach lässt sich dies in den verwendeten Tauschbörsenprogrammen auch nicht wirksam unterbinden, was von den Programmieren dieser Programme und dem größten Teil der Tauschbörsen-Community aber auch so gewollt ist. Anderenfalls würden nämlich viele ihren eigenen Upload ausschalten und ein „Tauschen“ der Musik- oder Videotitel wäre nicht mehr möglich, da jeder nur noch Downloaden würde aber niemand mehr die heruntergeladenen Files anbietet. Dass damit das gesamte System der Tauschbörsen in Mitleidenschaft gezogen würde liegt auf der Hand. Rechtlich stellt sowohl der Download, als auch der Upload von urheberrechtlich geschütztem Material einen Urheberrechtsverstoß nach § 97 UrhG dar. Vielfach wird die Auffassung vertreten, dass zumindest der Download legal sei, was aber nicht der Fall ist. Auch das vielfach zitierte Recht auf eine „Privatkopie“ rechtfertigt keinen Download urheberrechtlich geschützten Materials, da hierfür erforderlich ist, dass eine solche Kopie von einem legal erworbenen Medium erfolgt. Dies ist im Rahmen der Nutzung einer Tauschbörse jedoch nicht möglich, da die dort angebotenen urheberrechtlich geschützten Werke nicht für eine legale Kopie herhalten können. Obwohl auch der Download urheberrechtlich geschützten Materials illegal ist, gehen die oben genannten Rechtsanwaltskanzleien jedoch nur gegen diejenigen vor, die die Files im Internet öffentlich anbieten. Mir sind keine Fälle bekannt, in denen jemals wegen eines illegalen Downloads vorgegangen wurde. Mittels eigens entwickelter Programme werden deshalb diejenigen Nutzer von der Musikindustrie aufgespürt, die die Files anbieten. Dabei wird zunächst lediglich die IP-Adresse desjenigen Anschlusses ermittelt, über den die streitgegenständlichen Dateien angeboten wurden. Da die Rechteinhaber selbst keinerlei Möglichkeiten haben, den zugehörigen Anschlussinhaber ausfindig zu machen, wird durch die Rechtsanwaltskanzleien Strafanzeige wegen des Verdachts der Urheberrechtsverletzung gegen Unbekannt bei den Staatsanwaltschaften erstattet. Anhand der gewonnen Adressinformationen der Anschlussinhaber beginnt nun die eigentliche Arbeit der Rechtsanwaltskanzleien. Es kommt zu Abmahnungen gegenüber den Anschlussinhabern. Bei einer Abmahnung handelt es sich um die formale Aufforderung, ein bestimmtes Verhalten –vorliegend die Urheberrechtsverletzungen - künftig zu unterlassen. Rechtsgrund für die Abmahnung bildet § 97 Abs. I des Urhebergesetzes. Daneben statuiert diese Vorschrift Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatz, welche mit der Abmahnung oftmals zusammen geltend gemacht werden. II. Der Unterlassungsanspruch/Die strafbewährte UnterlassungserklärungAufgrund des Unterlassungsanspruchs steht dem Rechteinhaber ein Anspruch auf Abgabe einer strafbewährten Unterlassungserklärung zu. Diese ist regelmäßig der Abmahnung beigefügt und soll durch den Abgemahnten sehr kurzfristig unterzeichnet werden. Meist enthält sie die folgenden Punkte: 1. Vertragsstrafeversprechen: Sie verpflichten sich, eine bestimmte Handlung zukünftig zu unterlassen und versprechen, für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine bestimmte Vertragsstrafe zu zahlen. Die liegt im Normalfall über 5.000,00 EUR, da damit für den Fall, dass der Betrag von Ihrem Gegner eingeklagt werden muss, die Zuständigkeit eines Landgerichts und nicht eines Amtsgerichts gegeben ist. Durch das Vertragsstrafeversprechen wird die sog. Wiederholungsgefahr ausgeräumt, wenn die Vertragsstrafe eine angemessene Höhe hat und geeignet ist, den Störer von weiteren Rechtsverstößen abzuhalten. Beträge ab 5.000,00 EUR sind daher im Regelfall als angemessen anzusehen. 2. Fortsetzungszusammenhang: Sie werden aufgefordert, auf den sog. Fortsetzungszusammenhang zu verzichten. Davon ist jedoch abzuraten. Ihr Gegner will damit erreichen, dass jeder neue Verstoß in dieser Sache eine neue Verpflichtung zur Zahlung der Vertragsstrafe auslöst und nicht als ein einmaliger Verstoß gilt. 3. Zahlungsverpflichtung: Gleichzeitig enthalten die Unterlassungserklärungen eine Verpflichtung dem Abmahnenden sämtlichen Schaden zu ersetzen, der durch die Urheberrechtsverletzung entstanden ist. Diese Zahlungsverpflichtung ist regelmäßig nicht durch den Unterlassungsanspruch abgedeckt und sollte deshalb auch nicht unterschrieben werden. Es empfiehlt sich in der Regel die einfache Streichung dieser Passage der Unterlassungserklärung. Wenn Sie die strafbewährte Unterlassungserklärung unterschreiben, schließen Sie einen wirksamen Vertrag mit dem Rechteinhaber, aus dem Sie nicht mehr so leicht herauskommen: Vertrag ist Vertrag! Es wird zwischen den Parteien ein Dauerschuldverhältnis begründet, das Sie die nächsten 30 Jahre verpflichtet, Ihr Versprechen zu halten und im Falle der Zuwiderhandlung die vereinbarte Vertragsstrafe zu zahlen. Sie können daher nur bei einer Änderung der Rechtslage nachträglich die Abänderung des Vertrages verlangen oder bei Vorliegen eines Irrtums nach §§ 119 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) den Vertrag anfechten. Insbesondere Letzteres dürfte schwierig sein. Der Vertrag ist daher auch wirksam und verbindlich, wenn Sie die Unterlassungserklärung nur unterschreiben, um einem teuren Streit aus dem Weg zu gehen, ein Rechtsverstoß Ihrer Meinung nach aber gar nicht vorliegt! Bei lediglich 2 angemahnten Musiktiteln können deshalb die Gerichts- und gegnerischen Anwaltskosten in einem einstweiligen Verfügungsverfahren bereits leicht über 2.000.- € betragen.
Um dieses Risiko zu vermeiden ist deshalb anzuraten, die Unterlassungserklärung abzugeben, jedoch in einer Form, die lediglich dem Unterlassungsanspruch Rechnung trägt und worin Sie sich nicht gleichzeitig zur Zahlung der mit der Abmahnung verbundenen Rechtsanwaltskosten verpflichten. Hierbei kann Ihnen aber nur ein auf den gewerblichen Rechtsschutz spezialisierter Rechtsanwalt behilflich sein. Von Alleinversuchen kann nur dringend abgeraten werden. Neben der Vermeidung eines einstweiligen Verfügungsverfahrens hat die Abgabe der strafbewährten Unterlassungserklärung einen weiteren, nicht unerheblichen Vorteil. In Zukunft kann sich die Gegenseite mit Ihnen lediglich noch um den geforderten Schadensersatzanspruch, sowie die Kosten der Abmahnung streiten. Fazit: Die Abgabe der geforderten Unterlassungserklärung in modifizierter Form reduziert das zunächst bestehende Kostenrisiko erheblich und ist aus diesem Grund unbedingt zu empfehlen, unabhängig davon, ob eine Verpflichtung hierzu besteht oder nicht. Auch bei einer unberechtigten Abmahnung stellt die Nichtabgabe der Unterlassungserklärung aufgrund ungesicherter Rechtsprechung in diesem Bereich ein zu großes Risiko dar, als dass man darauf verzichten sollte. III. Haftung des Abgemahnten für die Rechtsverfolgungskosten des AbmahnersIst die Abmahnung berechtigt, müssen Sie grundsätzlich den Schaden tragen, der dem anderen durch den Urheberrechtsverstoß entstanden ist. IV. Schadensersatz für das Anbieten der abgemahnten Titel (?) Neben den Kosten für die Rechtsverfolgung wird oftmals aber auch Schadensersatz für das öffentliche Anbieten der Titel verlangt. a) der konkrete Schaden, insbesondere entgangener Gewinn b) der Verletzergewinn c) Schadenberechnung nach der Lizenzanalogie. Die ersten beiden Schadenspositionen haben das gemeinsame Problem für den Rechteinhaber, dass ein konkreter Schaden oder ein konkreter Verletzergewinn in irgendeiner Form beziffert werden muss, was sich in der Praxis oftmals als schwierig erweist. Gerade im Bereich des Filesharings wäre der konkrete Nachweis erforderlich, wie vielen Personen die angebotenen Musiktitel verschafft wurden. Praktisch ist dies nicht beweisbar. Da gerade bei dem kostenlosen Tauschen der Files auch kein Gewinn durch den Betreiber einer Tauschbörse erwirtschaftet wird, scheidet regelmäßig auch die Geltendmachung eines Verletzergewinns aus. Eine häufige Variante der Schadensbezifferung erfolgt daher nach der sogenannten Lizenzanalogie. Diese ergibt sich aus der Erwägung, dass derjenige, der Rechte anderer verletzt, nicht besser da stehen sollte, als er im Falle einer ordnungsgemäß erteilten Erlaubnis (Lizenz) durch den Rechtsinhaber gestanden hätte. Dies läuft letztlich auf die Fiktion eines Lizenzvertrages hinaus. Mit anderen Worten: Was hätte der Verletzer an Lizenzgebühren zahlen müssen, wenn er den Urheber oder Nutzungsberechtigten von Anfang an gefragt hätte. Die Schadenberechnung auf Grundlage einer Lizenzgebühr ist überall dort zulässig, wo die Überlassung von Ausschließlichkeitsrechten zur Benutzung durch Dritte rechtlich möglich und verkehrsüblich ist. Dies ist beispielsweise insbesondere bei Bildern und Fotografien der Fall, da es hier feste Sätze gibt, die auch durch die Rechtsprechung anerkannt werden. Praktische Probleme bei einer Berechnung des Schadens nach der Lizenzanalogie ergeben sich jedoch dann, wenn es eher unwahrscheinlich erscheint, dass der Nutzer eines urheberrechtlich geschützten Werkes tatsächlich eine Lizenz abgeschlossen hätte. Ein bekanntes Beispiel sind die Abmahnungen bei Urheberrechtsverstößen wegen der Nutzung der Grafik von einem Stadtplan im Internet. Hier verweisen die Verlage auf ihre Lizenz- und Nutzungsbedingungen, mit der Folge, dass zum Teil exorbitant hohe Forderungen zu zahlen sind. Es stellt sich jedoch die Frage, ob irgendjemand freiwillig 600,00 bis 1.000,00 Euro für den Ausschnitt eines Stadtplanes zahlen würde, den er für das gleiche Geld von einem Webdesigner neu hätte erstellen können und zwar mit Blattgoldumrandung. Interessant ist sicherlich auch, dass es bis heute kein Urteil gibt, welches einer Verwertungsgesellschaft oder einem Rechteinhaber einen Schadensersatzanspruch nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie bei der illegalen Nutzung von Tauschbörsen zugesprochen hat. V. Haftung für Filesharing durch Dritte?Wie bereits dargelegt wurde, haftet derjenige nach § 97 UrhG auf Unterlassung und Schadensersatz, der selbst die urheberrechtlich geschützten Werke im Internet angeboten hat. Unter der Voraussetzung, dass der Anschlussinhaber nicht der Täter war und auch von nichts wusste, ergibt sich die Frage, ob in diesen Fällen trotzdem der von den Verwertungsgesellschaften im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen aufgespürte Anschlussinhaber hierfür haftet. Eine Haftung des Telefonanschlussinhabers, der nicht selbst der Täter ist, kann nur nach den Grundsätzen der sogenannten „Störerhaftung“ in Betracht kommen. Angenommen, von einem Telefonanschluss werden beleidigende oder erpresserische Anrufe ohne Kenntnis und Willen des Anschlussinhabers getätigt. Sicherlich wird man diesen für den Inhalt der Telefonate nicht verantwortlich machen können. Ein weiteres Beispiel ist ebenfalls extrem: Die Post kann auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn ohne ihre Kenntnis rechtswidrige Inhalte in einem Brief verschickt werden. Des Weiteren begegnet es erheblichen Bedenken, einen Internetcafe-Betreiber für rechtswidrige Handlungen seiner Kundschaft im Internet in Anspruch zu nehmen. Die in Mode kommenden „Hotspots“, wo sich jeder an öffentlichen Plätzen kostenlos ins Internet einloggen kann, würden für die Betreiber ein enormes Risiko bergen, wenn diese für die Rechtsverletzungen der Nutzer als Störer in Anspruch genommen werden könnten. Dies hat natürlich auch der Gesetzgeber erkannt und entsprechende Regelungen in das Telemediengesetz (TMG) aufgenommen, die eine Haftung des jeweiligen Diensteanbieters auf Telekommunikationsebene regeln. Als Diensteanbieter gilt nach § 2 TMG jede natürliche oder juristische Person, die eigene oder fremde Telemedien (z.B. Internet) zur Nutzung bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt. In § 8 des TMG heißt es wie folgt:
(1) Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie in einem Kommunikationsnetz übermitteln oder zu denen sie den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich, sofern sie Eine Haftung für den Anschlussinhaber ist deshalb nur dann begründet, wenn dieser Kenntnis von den über seinen Anschluss begangenen Rechtsverstößen hat, da dieser grundsätzlich immer Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes ist, wenn er anderen seinen Internetzugang zur Verfügung stellt. Ob er dies gewerblich macht oder zu privaten Zwecken ist für die Anwendung der vorgenannten Vorschrift ohne Belang. An einer generellen Haftung des Anschlussinhabers - wie sie durch die abmahnenden Rechtsanwaltskanzleien behauptet werden - bestehen somit erhebliche rechtliche Zweifel. Entsprechende Urteile, die sich mit den Vorschriften des Telemediengesetzes befasst haben, können aktuell auch die abmahnenden Rechtsanwaltskanzleien nicht vorweisen. Auch die Pflicht des Anschlussinhabers den Internetzugang auf rechtswidrige Nutzung zu kontrollieren und zu überwachen besteht ausweislich von § 7 Abs. 2 TMG gerade nicht: "Diensteanbieter im Sinne der §§ 8 bis 10 sind nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen." Nach Entscheidungen des Landgerichts Hamburg, Urteil vom 26.07.2006, Az. 308 O 407/06, aber auch des OLG Düsseldorf, Beschluss vom 27.12.2007, Az. I-20 W 157/07, müssen aber gerade die Nutzer von frei zugänglichen Internetanschlüssen hinreichende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um einen Missbrauch durch Dritte auszuschließen. Vorgeschlagen werden dabei die Einrichtung von Portsperren, Mac-Adressfiltern und weitere, für den technischen Laien in der Regel unverständliche Schutzmaßnahmen. Nach Auffassung des LG Frankfurt am Main, Urteil vom 22.02.2007, Az. 2-03 O 771/06 muss sogar eine IT-Sicherheitsfirma beauftragt werden, um den Internetzugang entsprechend zu sichern. Dies alles sind aber Forderungen von Gerichten, die völlig unverständlich in Bezug auf die gesetzliche Regelung des § 7 Abs. 2 TMG erscheinen, was aber nicht zuletzt darin liegen mag, dass diese Vorschrift ausweislich der zuvor genannten Entscheidungen nicht durch die Gerichte auf ihre Anwendbarkeit hin überprüft wurde. VI. Spezialfall: Haftungsauschluß durch den Betrieb eines offenen W-Lan-Netzwerkes?Die Ausrede, man habe ein offenes-W-Lan Netzwerk betrieben, könnte deshalb scheinbar ein taugliches Mittel sein, die Ansprüche der Musikindustrie auf Schadensersatz und Unterlassung vollständig abzuwehren. Vielfach zitierte Urteile im Zusammenhang mit dem Betrieb offener W-Lan-Netze sind die Urteile des LG Frankfurt a.M. vom 01.02.2007 – 2/3 O 771/06 und das des LG Hamburg vom 26.7.2006 - Az. 308 O 407/06. Zu finden sind diese jedenfalls in jedem Abmahnschreiben, welches auf den Vorwurf von Urheberrechtsverletzungen durch Tauschbörsennutzung zurück zu führen ist. Während des LG Hamburg offensichtlich ergebnisorientiert die Schutzbehauptung hat abschneiden wollen, jemand habe das offene Funknetz gegen den Willen des Antragsgegners für die fragliche Urheberrechtsverletzung mißbraucht, scheint das LG Frankfurt a.M. dem Antragsgegner Glauben zu schenken, dass er selbst die Urheberrechtsverletzung nicht begangen hat. Trotzdem kommt das Gericht zu einem Unterlassungsanspruch aufgrund mittelbarer Störerhaftung. Unklar bleibt aber insbesondere bei dem Urteil des LG Frankfurt a.M., ob der Antragsgegner sein Funknetz unabsichtlich oder absichtlich offen betrieben hat, um ggf. Dritten freien Internetzugang zu gewähren. Das Gericht scheint aber davon auszugehen, dass dies unabsichtlich geschah, da es die Privilegierungen des § 7 ff. TMG mit keinem Wort erörtert. Hätte der Antragsgegner sein Funknetzwerk absichtlich der Öffentlichkeit zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt, fänden die §§ 7 ff TMG nach unbestrittener Ansicht Anwendung, weshalb nach h.M. der für die Störerhaftung relevante § 7 Abs. 2 TMG (Spindler, in: Spindler/Schmitz/Geis, TDG, § 8 Rn 13 ff) hätte diskutiert werden müssen. Weder in der Literatur, noch in der Rechtsprechung wurde bislang diskutiert, ob auch derjenige von §§ 7 ff TMG geschützt wird, der unbewusst Zugang zum Internet vermittelt. Die Frage stellte sich bisher bei drahtgebundenen Zugangsformen nicht, da der Zugang mittels eines Kabels durch die notwendige Anschaltung des Kabels nur schwer ohne Kenntnis des Betreibers vorstellbar ist. Für die Anwendung der § 7 ff TMG ist es auch nicht notwendig, dass der Betreiber jedem einzelnen Teilnehmer den Netzzugang willentlich vermittelt, sondern dass er dies generell willentlich tut. Sollten also einzelne Nutzer Zugangskontrollen überwinden und Zugang erlangen, so ändert dies nichts an der Haftungsprivilegierung des Betreibers. Er bleibt Anbieter von Telediensten, § 2 Nr. 1 TMG. Durch die weite Verbreitung der Funknetzwerke erlangt diese Frage nun aber Bedeutung, da hier jemand, der eigentlich kein Anbieter von Telediensten sein will, unfreiwillig einen Zugang zu Telediensten zur Verfügung stellen kann. Es stellt sich also die Frage, ob jemand, der rein tatsächlich ohne dies zu wollen, Zugang zu einem Kommuniationsnetz ermöglicht, einen „Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt“ (§ 8 Abs. 1 TMG). Ohne den Schutz der § 7 ff TMG wäre der Funknetzbetreiber straf- und schadensrechtlich nach den allgemeinen Regeln zu beurteilen. Dies würde allerdings zu Rechtsunsicherheiten für den Betreiber eines versehentlich offenen Funknetzes führen. Der Wortlaut des Gesetzestextes jedenfalls, der von einer Zugangsvermittlung spricht, schließt die Einbeziehung von ungewollten „Diensteanbietern“ nicht aus. Der Wortlaut geht auf Art. 12 ECRL zurück (Spindler, in: Spindler/Schmitz/Geis, TDG, § 8 Rn 21 ff) , der nur entgeltliche Dienste einbezieht. Entgeltliche Dienste werden aber immer gewollt erbracht. Durch seine Ausdehnung auch auf unentgeltliche und sogar private (!) Dienste hat sich der deutsche Gesetzgeber entschieden, auch Diensteanbieter in den Schutz der Haftungsregeln einzubeziehen, die dem ursprünglichen Zweck der Regelungen, Investitionen in Infrastruktur nicht behindern zu wollen, nicht fördern (Spindler/Schmitz/Geis, TDG, Vor § 8 Rn 1). Wenn also jeder Anbieter geschützt wird, der vorsätzlich seinen Internet-Anschluss öffentlich oder auch nur innerhalb der Familie zur Verfügung stellt, und damit nach Ansicht des Gerichts offensichtlich eine Gefahrenquelle eröffnet, dann müssen diejenigen, die ohne jede Kenntnis in fahrlässiger Weise ihren Internetanschluss zur Verfügung stellen aber erst recht privilegiert sein. Ihr Tatbeitrag wiegt jedenfalls geringer als der eines Anbieters, der bewusst handelt. Damit steht fest, dass der Antragsgegner ím Urteil des Frankfurt a.M. vom 01.02.2007 durch § 7 ff. TMG geschützt wird. Auf den Störeranspruch findet dabei § 7 Abs. 2 TMG Anwendung, welcher die Störerhaftung zwar nicht direkt regelt, jedoch über das Verbot allgemeiner Prüf- und Überwachungspflichten stark modifiziert. Prüfungspflichten werden aber dem Anbieter durch § 7 Abs. 2 Satz 1 TMG gerade eben nicht auferlegt. Ein Anspruch vor Kenntnis der durchgeleiteten Inhalte durch den Funknetzbetreiber besteht daher nicht. Ohne Anspruch führt der Abmahnende aber auch kein Geschäft des Abgemahnten, weshalb hierfür keine Kostentragungspflicht entsteht (Volkmann, Der Störer im Internet, 2005, S.109; Spindler NJW 2002, 921, 925). Die zuvor gemachten Ausführungen dürften zudem auch für einen Anbieter gelten, der sein W-Lan verschlüsselt betreibt, jedoch aufgrund der relativ leichten Umgehung einer WEP-Verschlüsselung Opfer eines Angriffs auf das Netzwerk wird, über das der Täter rechtswidrige Handlungen begeht. In diesem Fall wird auch die von den Gerichten angedachten Präventionsmaßnahmen in Form einer Verschlüsselung des Netzwerkes obsolet. Ein Betreiber eines kabellosen Internetzugangs ist vor solchen Gefahren momentan nur über die schwerer zu knackende WPA-Verschlüsselung sicher, wobei auch hier der ultimative Schutz vor unverhergesehen Abmahnungen regelmäßig der vollständige Verzicht auf das (kabellose) Internet bietet. Dies kann bei vernünftiger Würdigung der Sachlage allerdings kaum verlangt werden, wobei die zuvor genannten Gerichtsentscheidungen durch die Einrichtung von sicheren Schutzmaßnahmen gerade dies letzendlich (völlig unbegründetet) verlangen. Da leider sämtliche von den abmahneneden Kanzleien erstrittenen Gerichtsurteile einen Bezug zu den Vorschriften des Telemediengesetzes vermissen lassen, dürfte mit einer Wende in der bisherigen Rechtsprechung zu rechnen sein, sofern die gesetzlichen Haftungsregeln des Telemediengesetzes gerichtlich zur Sprache gebracht würden. Bislang wurden diese Vorschriften schlicht durch die entscheidenden Gerichte übersehen, was sicherlich daran liegen mag, dass es sich um wenig bekannte Vorschriften handelt und diese auch den Anwälten der Beklagten nicht bekannt waren. In der juristischen Literatur häufen sich zudem die Stimmen, dass die vorliegenden Urteile in Bezug auf die Thematiken Filesharing und Haftung des Anschlussinhabers schlichtweg falsch sind. VII. Verteidigungsstrategie oder "Wie verhalte ich mich richtig bei einer Abmahnung?"Sollten Sie abgemahnt worden sein, so empfiehlt es sich regelmäßig, einen mit der Materie vertrauten Rechtsanwalt aufzusuchen. Dieser wird die Vorwürfe prüfen und weitere Maßnahmen treffen. Die Möglichkeiten auf eine Abmahnung zu reagieren sind vielfältig und reichen vom völligen Untätigbleiben bis hin zur Abgabe der verlangten Unterlassungserklärung nebst Zahlung der Abmahnkosten des Abmahnenden. Zwischenschritte bieten sich oftmals in der Abgabe der Unterlassungserklärung bei gleichzeitiger Verwahrung gegen die Kostentragungspflicht an. Ein Untätigbleiben des Abgemahnten bietet sich dagegen in den seltensten Fällen an. Gerade bei Forderungen im Bereich von mehreren Tausend Euro bietet sich zudem im Hinblick auf die Kostenfolge auch ein Vergleich mit der Gegenseite an. Nicht selten lassen sich Forderungen von 5.000.- € leicht auf 1.000.- € oder weniger senken. Gerade bei solch hohen Schadensersatzsummen bringt die Akzeptanz eines geringen Schadensersatzes für den Abgemahnten immerhin die absolute Rechtssicherheit, dass keine weiteren Kosten oder Verfahren auf ihn zukommen. Auf jeden Fall ist jedoch regelmäßig bei Abmahnungen im Bereich Filesharing anzuraten, einen Rechtsanwalt mit der Vertretung zu beauftragen, der hinreichend Erfahrung auf diesem Rechtsgebiet vorweisen kann und sich besonders in den Bereichen des Computerrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes auskennt. _____________ |
||